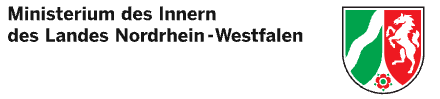Ich hatte jetzt schon viele Sozialfuzzis in meiner Wohnung, aber Sie sind die Erste, die diese Verbindung knüpft.
Mutter eines Teilnehmers
Programm "Kurve kriegen"
Da sich die Mutter verzweifelt fragte, warum ihr 13-jähriger Sohn immer im Herbst besonders auffällig wurde, sich zurückzog, die Schule verweigerte und in problematische Verhaltensweisen abrutschte, haben sie und die PFK sich gemeinsam das Leben und vor allen Dingen besondere Lebensereignisse des Jungen näher angeschaut.
Zuvor waren bereits einige Hilfen in der Familie tätig. Sie arbeiteten mittlerweile mit der zweiten Sozialpädagogischen Familienhilfe zusammen. Darüber hinaus hatte das Jugendamt noch eine Einzelfallhilfe installiert und die Schulsozialarbeit war involviert. Am Ende hatte die Mutter oft das Gefühl, dass sie sich alle gut verstehen würden, aber einfach nicht weiterkämen. Es kam ihr vor, als wäre sie regelmäßig nett zum Kaffeetrinken verabredet gewesen, dabei wollte sie doch eine Veränderung erzielen und nicht nur reden.
Zu zweit setzten wir uns an den Tisch und überprüften mögliche Auslöser für das Verhalten ihres Sohnes.
Pädagogischer Hintergrund
In der sozialpädagogischen Diagnostik geht es auch darum, Auslöser von bestimmten Verhaltensweisen herauszufinden und Verbindungen ins Hier und Jetzt herzustellen, daher ist die Biografiearbeit von großer Bedeutung.
Wir erstellen standardmäßig mit jeder neuen Familie eine Lebenslinie über die Entwicklungsgeschichte ihres Kindes. Erst nach einer vollumfänglichen Diagnostik starten wir mit der Zielplanung, somit ist kein Betreuungsverlauf bei Kurve kriegen gleich, sondern immer auf das Individuum zugeschnitten.
Fortsetzung der Betreuung
Mit Hilfe der Biografiearbeit lassen sich schwierige Lebensereignisse optimal herausarbeiten. Die Erkenntnis über diese herausfordernden Lebensphasen allein, verändert noch nichts. Doch das Verständnis, welches die Mutter ihrem Sohn anschließend entgegenbringen konnte, hat viel auf der zwischenmenschlichen Ebene bewirkt. Es gelang ihr, sich in ihren Sohn einzufühlen und dieser konnte sich wieder leichter öffnen. Mutter und Sohn haben begonnen, wieder an einem Strang zu ziehen. In der gemeinsamen Arbeit ging es anschließend nicht mehr um Sanktionen für bestimmte Verhaltensweisen, sondern darum, was ihr Sohn braucht, um andere Verhaltensweisen zu erlernen, wer mögliche Unterstützer*innen sein können und welche seiner Ressourcen er dafür nutzen kann.
Das Erstgespräch liegt mittlerweile zwei Jahre zurück. Heute ist der Jugendliche ein Absolvent der Initiative und es sind auch keine weiteren „Sozialfuzzis“ mehr in der Familie tätig.